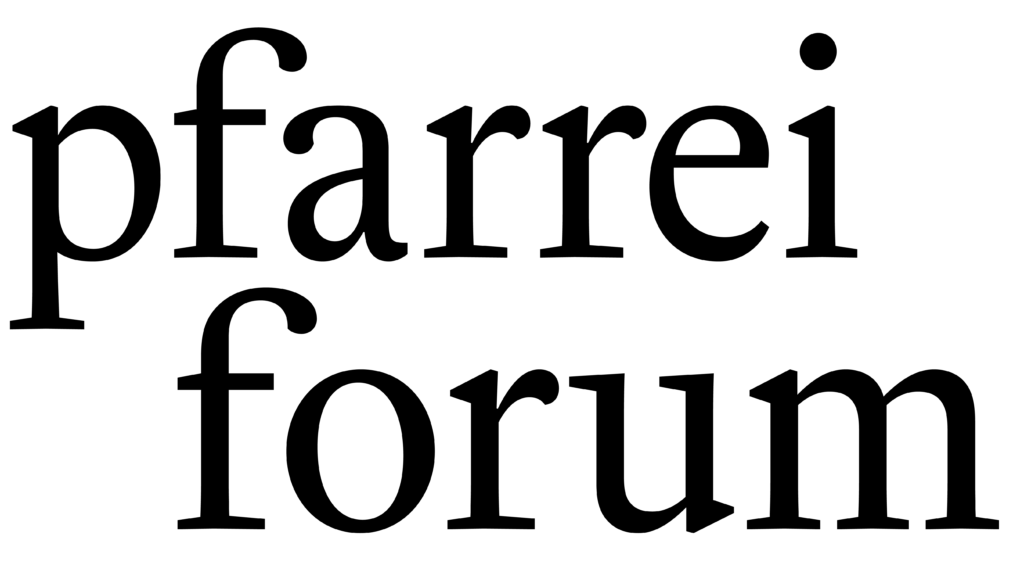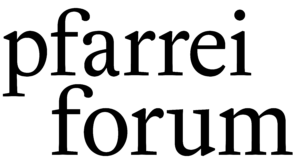«Du bist ja schliesslich ein Mann»
I. B.* (64) aus dem Bistum St. Gallen steht mit beiden Beinen fest im Leben, bis er durch die Scheidung in arge Schwierigkeiten gerät. Sein Lohn wird gepfändet und er lebt jahrelang am Existenzminimum. Wie findet er aus der Krise heraus?
In seinen guten Jahren hat I. B. Freude im Beruf. Er engagiert sich in der Bergrettung und bei der Feuerwehr. In der Freizeit ist er viel in den Bergen unterwegs, am liebsten in Kletterausrüstung an einer Felswand. Nach privaten und finanziellen Problemen folgt eine persönliche Gratwanderung, die viel von ihm abverlangt. Der Mann aus den Bergen ist in einfachen Verhältnissen oberhalb der Nebelgrenze aufgewachsen. «Wir lebten sehr abgeschieden. Wir hatten keinen Strom und einen langen Schulweg. Aber wir hatten immer genug zu essen und wir erlebten dort oben eine gute Jugendzeit», erinnert er sich. Nach der Schule schliesst er eine Ausbildung auf dem Bau ab und arbeitet über längere Zeit im Hochbau. Später nimmt er eine Saisonstelle im Gastgewerbe an und baut im Sommer jeweils Natursteinmauern. Zu dieser Zeit ist er auch Mitglied der alpinen Bergrettung und im Kader der örtlichen Feuerwehr. Zudem chauffiert er als Militär verschiedene Bundesräte und ranghohe Politiker. «Das waren interessante Begegnungen, die ich nicht missen möchte», erzählt er weiter. Auch sein Privatleben scheint stabil zu sein: Er ist verheiratet und Familienvater.
Abwärtsspirale
Finanzielle und andere Probleme, auf die er nicht weiter eingehen möchte, führen schliesslich zur Scheidung von seiner Ehefrau. Eine Laienbehörde entscheidet, dass sein Lohn fortan gepfändet wird. «Nach der Scheidung 1997 ging es abwärts. Ich musste nur noch zahlen und hatte selbst nichts mehr», beschreibt er seine damalige Situation als geschiedener Mann und Vater. Er leidet, erfüllt kaum mehr Pflichten und weicht Problemen aus. Wenn er in seinem Umfeld nach Hilfe fragt, bekommt er etwa zur Antwort: «Du schaffst das schon, du bist ja schliesslich ein Mann!» Der Kontakt zur Familie bricht ab. Er verliert das Vertrauen in Ämter, weil er sich ihnen ausgeliefert fühlt. Die Abwärtsspirale zieht ihn weiter nach unten. Das Gefühl, versagt zu haben, wird immer grösser. Bis zum Moment, an dem er allen Mut zusammennimmt und beim Kirchlichen Sozialdienst anklopft. «Ich dachte, entweder gehst du jetzt zu dieser Tür rein oder du stürzt irgendwo in den Bergen ab.»
Der Wendepunkt
Beim Kirchlichen Sozialdienst bekommt I. B. die dringend nötige Hilfe. Hier sei er endlich ernst genommen worden und er habe sich verstanden gefühlt. «Es ist kein Amt, die Atmosphäre ist persönlicher, angenehmer.» Die Sozialarbeiterin unterstützt ihn auf dem Weg zurück in ein geregeltes Leben. «Sie hat mich zu den Ämtern begleitet und mir geholfen, wieder einen festen Wohnsitz zu finden und meine Ausweise zurück zu erlangen.» So einfach sei es aber nicht gewesen. Entscheidend ist für ihn, dass er – nach langem Kampf – eine Berufsbeiständin erhält. Seither regelt sie die Finanzen und schreibt alle Behördenbriefe für ihn. «Das ist eine enorme Entlastung für mich», sagt er dankbar. «Ich habe zwar ein sicheres Auftreten und kann gut Leute führen, aber gewisse Sachen kann ich einfach nicht.» Die Beiständin steht ihm zur Seite und führt die Korrespondenz mit verschiedenen Ämtern. Sie kann bewirken, dass ihm nebst seinen bescheidenen Erwerbseinnahmen ein verlässliches Grundeinkommen zusteht. Eine IV-Rente erhält I. B. aufgrund einer Diagnose, die nach seinem Schlaganfall zufällig entdeckt wird. I. B. hat sich erstaunlich gut von diesem Vorfall erholt und kann mit Medikamenten gut damit leben.
Gute Gesundheit
Heute geht I. B. einem geregelten Alltag nach und steht auch finanziell wieder auf eigenen Beinen. Er lebt in einer Wohngemeinschaft in einem Bauernhaus und kümmert sich um leichte Arbeiten auf dem Hof und im Haus. Er fühlt sich nach wie vor stark zu den Bergen und zur Natur hingezogen. Ab und zu besucht er einen Freund auf seiner Alphütte und geniesst dort oben das Bergpanorama. Wenn er zurückschaut auf die schwierige Zeit, empfindet er tiefe Dankbarkeit für die Hilfe, die er bekommen hat. Für die Zukunft wünscht er sich gute Gesundheit und dass er immer ein bisschen etwas zu arbeiten hat. «Und vielleicht gehe ich auch wieder einmal auf eine einfache Kletterroute», fügt er schmunzelnd an.
*Der Name ist der Redaktion bekannt. Auf Rücksicht gegenüber der Privatsphäre wird auf persönliche Angaben verzichtet.
Text: Katja Hongler
Bild: Ana Kontoulis