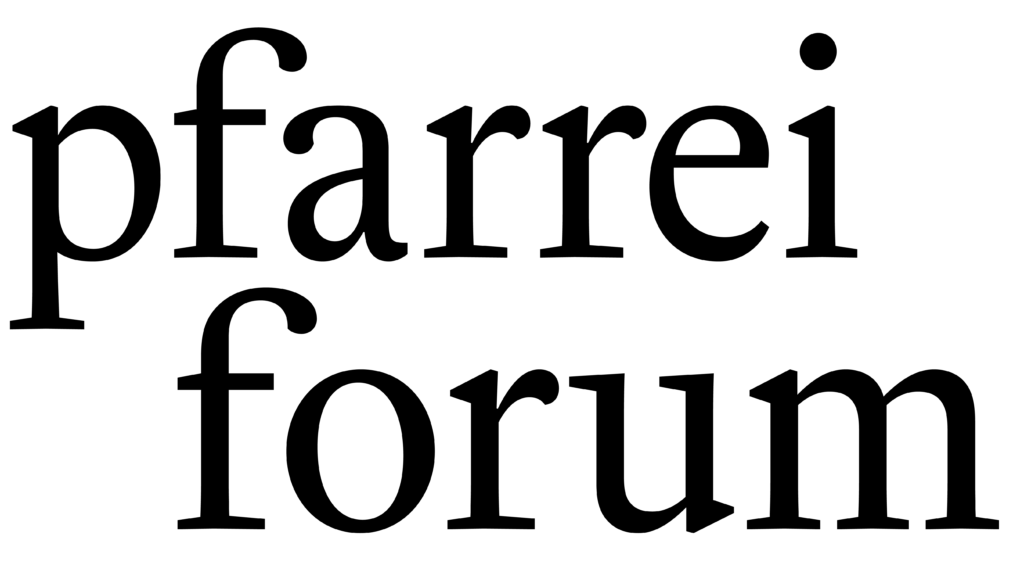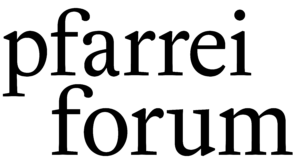Spontane Gespräche mit dem Papst
Mittelalterliche Fluchtwege, eine Touristenattraktion als Geheimtipp und ruhige Ecken, um über Demut und das Leben nachzudenken: Der Gossauer Nicola Damann gibt einen Einblick in seinen Alltag als Schweizergardist im Vatikan und erzählt, welche Orte in Rom ihm am besten gefallen.
Manchmal sind es kurze Begegnungen, die unser Leben für immer verändern. So geschehen bei Nicola Damann. Der heute 24-Jährige war 2014 Teilnehmer an einer Ministrantenreise nach Rom. Dazu gehörten ein Besuch im Vatikan und eine Führung in der Schweizergarde. Dieses Erlebnis prägte Nicola Damann nachhaltig. «Ich war sehr beeindruckt und seither hatte ich den Gedanken, Gardist zu werden.» Gesagt, getan. Nach einer KV-Lehre bei der Stadtverwaltung Gossau und einem Mandat im Gossauer Stadtparlament packte Nicola Damann seine Koffer und meldete sich zum Dienst. «Gardisten zeichnen sich durch viele gute Eigenschaften aus: Loyalität, Tapferkeit, Demut. Es ist eine gute Lebensschule. Es sind alles Werte, die für mich privat und beruflich viel zählen. Ich bin sehr gerne Schweizergardist.»

Intensive, lehrreiche Monate
Nicola Damann reiste im Januar 2024 nach Rom und durchlief wie alle Gardisten eine vielseitige Ausbildung. Einen Monat davon verbrachte er in Rom. Danach folgten vier Wochen im Ausbildungszentrum der Spezialkräfte der Schweizer Armee in Isone im Tessin, die Kantonspolizei bildet die Gardisten vollumfänglich aus. Der Abschluss und die Vorbereitungen für den Dienst fanden wiederum in Rom statt. «Es war intensiv, aber wir durften sehr viel erleben und lernen.»

Karwoche als erstes Highlight
Kurz nach dem Diensteintritt erlebte Damann schon sein erstes Highlight. «Die intensive Karwoche und die Ostern mit dem Heiligen Vater waren sehr eindrücklich. Am Ostersonntag besuchten zirka 50 000 Personen die heilige Messe auf dem geschmückten Petersplatz und wir als Gardisten durften auch dort Dienst leisten. Das ist schon speziell und schön.» Im Mai 2024 schliesslich wurde Damann mit 33 anderen Gardisten in einer Zeremonie im Vatikan vereidigt. Die Vereidigung war für Hellebardier Damann ein prägendes Erlebnis. «Mit dem abgelegten Schwur bekennt man sich dazu, der Kirche, dem Papst und der Schweizergarde aus innerster Überzeugung zu dienen. Dies ist eine grosse Ehre.» Die meiste Zeit des Tages verbringt Nicola Damann im Vatikan. Noch heute staunt er manchmal über die riesigen Menschenmassen auf dem Petersplatz, die an Ostern jeweils ihren Höhepunkt erreichen. Täglich strömen rund 10 000 Menschen in den Vatikan. Im Hinblick auf die Warteschlangen vor den Vatikanischen Museen, der Sixtinischen Kapelle und dem Petersdom gibt Nicola Damann einen wichtigen Tipp: «Vorgängiges Informieren lohnt sich.» Für die Römerinnen und Römer sind die zahlreichen Besucherinnen und Besucher nicht immer einfach. «Teilweise leidet die Stadt Rom und der Vatikan unter den Touristenmassen», so Nicola Damann. Wenn die Gardisten während ihres Wachdienstes von Menschen für Fotos bedrängt und ungefragt abgelichtet werden, ist das für sie Alltag. «In solchen Situationen muss man ruhig und beherrscht reagieren.»

Treffen mit dem Papst
In seine Rolle als Gardist hat sich Nicola Damann eingelebt. Er wohnt mit den anderen Gardisten in einer Kaserne im Vatikan. Die Schweizergarde ist rund um die Uhr im Einsatz. Hat Nicola Damann Morgendienst, ist er bereits vor fünf Uhr auf den Beinen. Nach dem Frühstück poliert er Schwert und Gürtelschnalle, wechselt den weissen Uniformkragen und die weissen Manschetten und zieht seine Uniform an. Dann tritt er seinen Dienst an. Mit den anderen Gardisten, alles praktizierende Katholiken, versteht sich Damann gut. «Wir haben alle dieselbe Einstellung und denselben Berufsalltag. Wir sind eine Familie.» Und wie ist das Verhältnis der Gardisten zum katholischen Oberhaupt? «Wir treffen den Heiligen Vater oft im Dienst. Er grüsst uns und nimmt sich oft Zeit für spontane Gespräche.» Diese Nahbarkeit schätzt Nicola Damann sehr.

Suche nach Ruhe
Meist sind die Gardisten für den ordentlichen Wachdienst eingeteilt. Nicola Damann macht seinen Dienst am liebsten im Apostolischen Palast, genauer gesagt in der Sala Regia. «Der Raum ist reich an Kunst mit wunderschönen Fresken und Geschichte. Verbunden mit der Stille, die dort meist herrscht, ist der Ort für mich unvergleichlich. Dort kann auch ich zur Ruhe kommen. Rom erschlägt einen manchmal. Dazu tut Stille gut. Sie ist wichtig, um den Glauben zu leben und sich Gedanken über die Zukunft zu machen.» Wenn er keinen Dienst hat, verbringt Nicola Damann seine Zeit gerne in den Vatikanischen Gärten, seinem persönlichen Rückzugsort mitten in der hektischen Stadt. Ein Privileg, das nur die Mitarbeitenden des Vatikans haben. Aber Nicola Damann beruhigt: «In Rom hat es zahlreiche, wunderschöne Pärke. Wer Ruhe sucht, findet sie dort. Und es gibt überall kleine Kapellen, die wenig besucht sind. Es lohnt sich, die Augen offen zu halten.»

Besonderheit Engelsburg
Angesprochen auf einen Tipp für Touristinnen und Touristen nennt er mit der Engelsburg erstaunlicherweise eine der meistbesuchten Touristenattraktionen. Nicola Damann lacht und erklärt: «Vor der Burg sind immer zahlreiche Menschen, drinnen allerdings nicht, vor allem morgens. Und von der Dachterrasse aus hat man einen wunderschönen Blick auf den Petersdom.» Zur Engelsburg hat Nicola Damann, wie wahrscheinlich alle Gardisten, eine besondere Beziehung: Der Apostolische Palast im Vatikan ist durch den sogenannten Passetto mit der 800 Meter entfernten Engelsburg verbunden. «Während der Plünderung Roms im Jahr 1527, Sacco di Roma genannt, nutzte Papst Clemens VII. die Engelsburg als Zufluchtsort. Die Schweizergarde beschützte den Papst, 147 Gardisten kamen damals ums Leben», so Nicola Damann. Die alljährliche Vereidigung findet noch immer am Jahrestag dieser Heldentat statt, am 6. Mai.
Lebensstil gefällt
Gerne geht Nicola Damann auch mit seinen Kollegen zum Abendessen in eines der typischen italienischen Restaurants oder trinkt am Ufer des Tibers ein Glas Wein. «Auf der Isola Tiberina hat es wunderbare Sitzgelegenheiten. Da können wir gut verweilen.» Nicola Damann mag den italienischen Lebensstil und das südländische Flair. «Italienerinnen und Italiener sprechen viel. Sie haben eine sehr positive Lebenseinstellung und haben mehr Lebensfreude. Sie sind mit wenig zufrieden. Und darum geht es doch im Leben», so Damann. Im Gespräch kommt er immer wieder auf die Demut zu sprechen. Sagt Sätze wie: «Geld und Materielles ist nicht das Wichtigste im Leben. Für mich ist beides nicht erstrebenswert.» Sein Sprichwort, passend: Weniger ist manchmal mehr. «Glaube leben heisst auch, mit einfachen Dingen glücklich sein.»


Persönliche Tipps von Nicola Damann
Ristorante «La Vittoria»
Nur wenige Gehminuten vom Vatikan entfernt befindet sich an der Via delle Fornaci 15 im historischen Zentrum Roms das Ristorante «La Vittoria», eines der Lieblingsrestaurants von Nicola Damann. Gerne gönnt er sich hier ein typisches italienisches Abendessen unter Römerinnen und Römern. «Das Tiramisu ist superlecker. Und es gibt ein spezielles Garde-Menü und einen Garde-Limoncello.»
Villa Doria Pamphilj
Die Villa Doria Pamphilj (auch Doria Pamphili) ist eine grosse Parkanlage an der Via Aurelia Antica westlich des historischen Stadtteils Trastevere, rund 1,5 Kilometer vom Vatikan entfernt. Sie wurde im 17. Jahrhundert angelegt und ist mit einer Fläche von rund 1,8 Quadratkilometern eine der grössten Parkanlagen Roms. «Es ist ein wunderschöner Park. Hier kann man auch gut ein wenig Sport treiben mitten in der Grossstadt», so Nicola Damann.
Isola Tiberina
Die Isola Tiberina (Tiberinsel) ist eine kleine Insel im Fluss Tiber. Sie ist etwa 270 Meter lang und bis zu 67 Meter breit. Die Insel wird seit dem späten 19. Jahrhundert von der jüdischen Gemeinde Roms genutzt, die dort unter anderem ein Krankenhaus unterhält und 1937 eine Synagoge, den Tempio dei Giovani, einrichtete. Heute befinden sich auf der Insel die Basilika San Bartolomeo all’Isola und ein vom Orden der Barmherzigen Brüder geführtes Krankenhaus (Ospedale Fatebenefratelli). «Es gibt eine herzige kleine Kirche und in der Nähe gibt es super Sitzgelegenheiten – ideal für Gespräche und Treffen mit Freunden, oder um ein Buch zu lesen. Vor allem am Abend ist es sehr romantisch auf der Tiberinsel», sagt Nicola Damann.
Text: Alessia Pagani
Bilder: Martina Caroli, Rom
Veröffentlichung: 24.04.2025