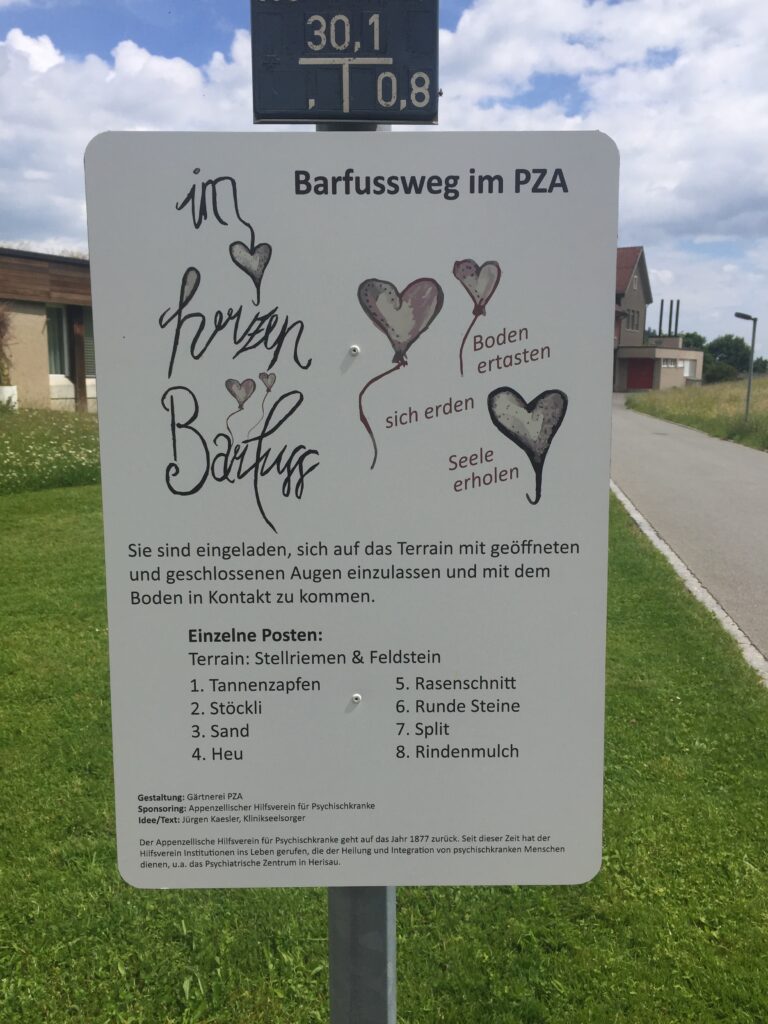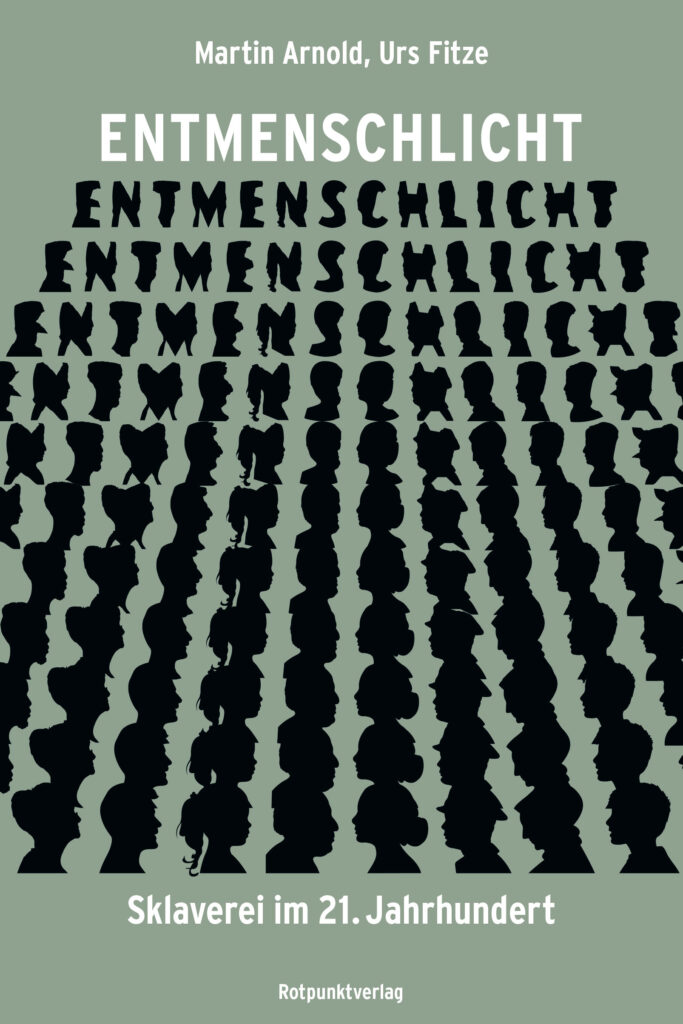«Das Stigma ist gross»
Maria Magdalena, das Beratungsangebot des Kantons St. Gallen für Sexarbeitende, bietet seit Frühjahr jede Woche in Buchs, Uznach und St. Gallen ein «Café des Professionelles» an. Es geht dabei um Austausch, aber auch um Gesundheitsthemen und rechtliche Fragen.
Der Tisch ist gedeckt, Kaffeetassen, ein Kuchen, Guetzli, eine Schale mit frischen Kirschen stehen bereit. «Mit unserem Café wollen wir Sexarbeitenden die Möglichkeit geben, sich auszutauschen», erklärt Margot Vogelsanger, Psychologin und Teamleiterin des Beratungsangebots Maria Magdalena. «Die Teilnehmenden erhalten aber auch Inputs zu Gesundheitsthemen, rechtlichen Fragen oder auch zum Selfmarketing.» Dazu gehören zum Beispiel Fragen rund um den Datenschutz. Das Café erfülle auch die Funktion von Selbsthilfe. «Manchmal sprudelt es nur so.» Und bei sprachlichen Missverständnissen helfe auch schon mal die Übersetzungsfunktion von Google. Die Cafés stossen bis jetzt auf unterschiedliche Resonanz: Manchmal seien sechs oder mehr Gäste bei einem Café, manchmal tauche auch niemand auf.
Zusammenarbeit mit Caritas
Ein Thema beschäftige gegenwärtig viele: Seit der Corona-Pandemie hat die Nachfrage nachgelassen. «Woran das genau liegt, weiss man nicht», sagt Margot Vogelsanger, «aber ein Grund ist sicherlich die Digitalisierung.» Einerseits ermöglichen Apps und Online-Portale Sexarbeitenden mehr Selbstständigkeit, da sie ihre Dienstleistungen online bewerben können. Andererseits vergrössern sie die Konkurrenz. «Apps wie Tinder haben die Ware Sex viel schneller verfügbar gemacht. Es kommt immer häufiger vor, dass Amateure ihre Dienstleistungen anbieten.» Die existenziellen Notlagen nehmen zu. Laut Jahresbericht 2021 von Maria Magdalena sind finanzielle Fragen bei den Beratungsgesprächen ein grosses Thema: 30 Prozent der Gesprächsthemen beschäftigten sich damit. «Wir sind froh, auf die Zusammenarbeit mit der Caritas zählen zu können», sagt Margot Vogelsanger. «Die Caritas unterstützt Sexarbeitende bei der Schuldenberatung oder bietet mit den Caritas-Märkten in St. Gallen und Wil die Möglichkeit, günstig einzukaufen.» Während der Corona-Pandemie hätten zudem Caritas und der Katholische Konfessionsteil des Kantons St. Gallen Spendengelder für Sexarbeitende, die in finanzielle Not geraten sind, zur Verfügung gestellt.

Gesellschaftliches Stigma
Die Frage nach dem Ausstieg aus dem Beruf sei bei den Cafés bisher kaum ein Thema gewesen. «Wenn, dann taucht so etwas in Einzelgesprächen auf, aber auch das eher selten», so Vogelsanger. Viele Branchen suchen momentan nach Personal und die Chancen für Quereinsteigerinnen und ‑einsteiger sind gut, denkt da trotzdem niemand an den Ausstieg? «Es mag wohl manche überraschen, aber viele Sexarbeitende machen ihren Beruf gerne», betont Margot Vogelsanger. «Falls jemand aussteigen will, ist das oft eine Herausforderung. Das gesellschaftliche Stigma ist gross. Sie können ja bei der Bewerbung nicht offen angeben, was sie bisher gemacht haben. Ich habe mir schon mit Klientinnen den Kopf zerbrochen, wie genau sie das in ihrem Lebenslauf formulieren, ohne dass die Tür gleich wieder zugeht.» Für viele Berufe seien auch die sprachlichen Hürden zu hoch.
Vielfalt der Biografien
Margot Vogelsanger ist seit zwei Jahren bei Maria Magdalena tätig. Sie persönlich habe die Vielfalt der Biografien überrascht: «In den Medien werden meist nur Klischees gezeigt: Auf der einen Seite Frauen als Opfer von Ausbeutung und Menschenhandel, auf der anderen Seite die Models, die perfekt aussehen. Natürlich gibt es beides, aber das sind eher die Ausnahmen. Die Realität ist viel differenzierter.» In der Schweiz geht man nach einer Studie von 4000 bis 8000 Sexarbeitenden aus. Doch in der Ostschweiz finde Sexarbeit meist im Verborgenen in Privatwohnungen statt. «Das macht es für uns schwieriger, mit ihnen in Kontakt zu kommen und auf unser Angebot aufmerksam zu machen.» Bei der Beratung hätten Fragen rund um Prävention von übertragbaren Krankheiten, aber auch rechtliche Fragen einen zentralen Stellenwert «Aber häufig geht es um Themen, die Menschen in allen gesellschaftlichen Milieus beschäftigen: Probleme in der Ehe oder mit den Kindern, Stress, der Umgang mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen …»

Name als Türöffner
Das Beratungsangebot für Sexarbeitende trägt den Namen einer biblischen Person. Margot Vogelsanger schmunzelt: «Warum die Verantwortlichen bei der Gründung unseres Angebots vor 22 Jahren auf Maria Magdalena gekommen sind, weiss ich nicht. Aber ich erlebe diesen Namen oft als Türöffner. Vor allem Sexarbeitende aus südamerikanischen Ländern, aber auch aus Osteuropa wissen sofort etwas mit dem Namen anzufangen, sie fühlen sich angesprochen und reagieren positiv darauf.»
Text: Stephan Sigg
Bilder: Ana Kontoulis
Veröffentlicht: 09. August 2022